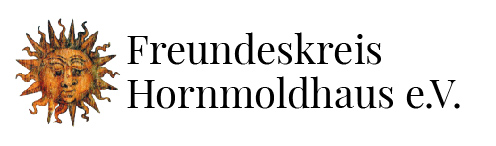Über
Das Hornmoldhaus
Das Bietigheimer Hornmoldhaus
Der Bauherr
Sebastian Hornmold (1500 – 1581) Auftraggeber des Hornmoldhauses, Sohn des Stadtvogts Adam Hornmold und Schwager des bayerischen Kanzlers Konrad Braun. Direktor des Kirchenrats der evangelischen Landeskirche bis 1565. Nutzte seinen Einfluss zum Vorteil der Stadt Bietigheim: Privileg des Holzhandels an der Enz, wichtige Wirtschaftsgrundlage bis in die Mitte des 19. Jhd. Sitz eines der vier Arztstellen landesweit und damit Ort einer der vier Apotheken im Herzogtum. Erwerb des Nippenburgischen Stadthauses als künftigen Sitz der Lateinschule mit nachhaltiger Wirkung auf die Bildung in der Stadt. Beginn der Bietigheimer Weinrechnung ab 1550 als wichtige Wirtschaftsgrundlage. Begründer der Bietigheimer Annalen und damit der Bietigheimer Geschichtsschreibung.
Baugeschichte des Hornmoldhauses
Sebastian Hornmold erhält nach der 1534 erfolgten Rückkehr Herzog Ulrichs das Haus der Johannespfründe in Bietigheim geschenkt. Von der Johannespfründe stammt noch die steinerne Nordwestecke im Erdgeschoss des Hornmoldhauses mit den Resten eines spätgotischen Fensters und der Jahreszahl 1526, die, abgeändert in 1536, den Bau des Hornmoldhauses anzeigt.
Wohl ab 1536 als Fachwerkbau errichtet mit hervorragendem Zierfachwerk auf der Giebelseite – geschweifte Andreaskreuze. Der Giebel weist als seltene Besonderheit Asymmetrie auf: optischer Ausgleich der Fenstererker von zwei Bohlenstuben.
1556 Errichtung des Galeriegebäudes nach Süden als „Brücke“ zu einer Scheune. Darin die sehr weiträumige Sommerstube I . Sommerstube nennt man, große und besonders ausgestaltete, aber nicht heizbare Räume für Feste im Sommer.
1575 Abriss der genannten Scheune und Neubau mit der Sommerstube II, die Sommerstube I wird aufgegeben.
Nach 1620 steinernes Prunkportal an der Giebelseite, datiert 1625; aus derselben Zeit an der Nordostecke eine für Süddeutschland ungewöhnliche steinerne Zier-Sitznische. Weitere Steinmetzarbeiten, Kapitelle, Stützen, im und am Haus. Auf der Ostseite ein Küchenanbau in Stein und Fachwerk als Durchfahrt in den Innenhof. In das Erdgeschoss wurde wohl um 1900 eine Bäckerei eingebaut.
Ausstattung mit Malereien
Zuerst dürften die wichtigsten Innenräume mit einfachen Begleitlinien des auch innen sichtbaren Gebälks versehen worden sein.
1557 werden das Erdgeschoss, das untere Treppenhaus, der Untere Ern und die Sommerstube I im Geschmack der Zeit ausgemalt: die Balken des Fachwerks mit illusionshaften marmorierten Elementen und Rosetten, die Deckenfelder des Unteren Erns mit eindrucksvollem Grotesken- und Rankenwerk.
1575 das obere Treppenhaus und der Obere Ern mit reichen Rosetten und Groteskenwerken z.T. in den teuren Farben blau, hellrot und grün. Antike Köpfe und Gefäße als dekorative Malereien. Überraschend die Darstellung eines Narren. Das herzogliche und das hornmoldsche Wappen an Wänden einander gegenüber; an einem Pfosten findet sich gegenüber einer Sonne vermutlich eine Darstellung des Gesichtes des alten Hornmolds. In der Sommerstube II wird die Decke mit gotisierenden Gabelblattranken, prunkvollen Rosetten, dem Lamm Christi und einem Fratzengesicht bemalt.
Ebenfalls von 1575 zwei Decken-Medaillons: papstkritische Vexierbilder mit satirischen Umschriften: Papst – Teufel, Kardinal – Narr, nach einer Medaille von 1545. Wohl Bezug zur badischen Kanzlerschaft Samuel Hornmolds, eines Sohnes Sebastian Hornmolds. Die Bemalung der Wände blieb unvollendet.
Nach 1620 im Oberen Ern erfindungsreiche illusionistisch frühbarocke Portale über der Bemalung von 1575. In der Sommerstube II Bemalung der Wände: illusionistische Scheinarchitekturen mit Bögen und Balustern. Biblische Szenen wechseln mit profanen Darstellungen wie Jagdmotiven und vielleicht eines Indianerkopfes. Die scheinbaren Durchblicke zwischen den Balustern unterhalb der Decke ins Freie als Raumgestaltungsprinzip dürften in Deutschland einmalig sein. In Türnähe die Initialen IHS, sie bedeuten hier unter Abänderung des Christusmonogramms Johann Sebastian Hornmold (1570 – 1637), Kirchenratsdirektor wie sein Großvater und Auftraggeber.
Der Mannesstamm der Bietigheimer Familie stirbt im Dreißigjährigen Krieg aus. Unter dem Stadtarzt Friedrich Haag (1628 – 1689), der eine Nachfahrin Hornmolds zur Frau hatte, noch die Bemalung der Schlafkammer mit eleganten Arabesken – nur in Resten erhalten.
Im späten 18. Jhd. in der Galerie beachtenswerte Bauernmalereien. Im 20. Jhd. Verfall, obwohl unter Denkmalschutz. Die Malereien bis auf die Sommerstube verdeckt. In den Siebzigern sollte das Haus abgerissen werden.
Historie

1535-36
Die Bauzeit
Der Bietigheimer Stadtschreiber Sebastian Hornmold ließ seinen prächtigen Wohnsitz im Jahre 1535-36 errichten. Der repräsentative Bau prägte über Jahrhunderte das Stadtbild und vermittelt heute das Selbstverständnis und Lebensgefühl des Bürgertums einer aufstrebenden Landstadt im 16. Jahrhundert.
Bohlenstube
Als Bohlenstube werden die Räume bezeichnet, die in massiver Ständerbohlenweise errichtet wurden. Wände und Decken bestanden vollständig aus dem teuren Baumaterial Eichenholz, das eine gute Isolierung bot. Die drei Bohlenstuben des Hornmoldhauses dürften daher als zentrale Wohnräume gedient haben. Da sie auch von außen erkennbar waren, demonstrierte Hornmold hiermit ganz offen Stellung und Wohlstand.


Sommerstube
In der früheren Scheune, hoch über der Stadtmauer befindet sich die so genannte "Sommerstube". Dieser im Jahr 1575 entstandene, nach Süden ausgerichtete Raum verdankt seine Bezeichnung der Tatsache, dass er nur während der Sommermonate genutzt wurde. Seine Ausmalung erfolgte in zwei Phasen.
1545-1625
Umbauten
Vermutlich waren Haus und Scheune zunächst nur durch einen schmalen Übergang verbunden. Der Einbau der Sommerstube nach 1545 dürfte Anlass gewesen sein, die Galerie deutlich zu verbreitern. Der Übergang zur Scheune blieb allerdings noch bis in das Jahr 1623 hinein zur Hofseite hin offen. Um 1625 wurde das äussere Erscheinungsbild modernisiert und dem inneren Prunk angepasst: die ursprünglich spätgotischen Fenstereinfassungen wurden durch solche im Renaissancestil ersetzt, das prächtige Eingangsportal eingefügt.


Die Fassade
Ein Schmuckstück des Hornmoldhauses ist die prachtvolle Fassade der nördlichen Giebelseite. Ihre Gestaltung verbindet traditionelle und sehr moderne Fachwerkarchitektur des frühen 16. Jahrhunderts. Die rote Farbfassung des Fachwerks mit der schwarzen Doppelbandelierung und den weißen Gefachfeldern entspricht dem historischen Befund.
Malereien
Ein hervorragendes Zeugnis für den Lebenssstil der Renaissance sind die Malereien im Hornmoldhaus. Bebilderungen sind in nahezu allen Räumen als Wandgestaltung oder Deckenornament zu finden.


1900
Verfall
Im 19. Jahrhundert war aus dem ehemals stattlichen Bürgerhaus eine Bäckerei mit Ausschank geworden. Die Innengestaltung wurde entsprechend stark verändert, einzelne Wände versetzt, bemalte Wandbretter in den Fußboden eingesetzt. In den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts war nichts mehr von der alten Pracht zu erkennen. Die Stadt, mittlerweile Eigentümerin, erwog, das Hornmoldhaus im Rahmen der geplanten Rathauserweiterung abzureißen.
1967-81
Ausstellungen & Restaurierung
Seit Anfang der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts befindet sich das Hornmoldhaus in städtischem Eigentum. Ab 1967 nutzte die Stadt den Eingangsbereich als Ausstellungsraum. Bis in die 70er Jahre hinein blieb es beim vom Abbruch bedrohten Ausstellungsprovisorium. Der notwendige Rückbau, die Freilegung und Restaurierung von Fassade und Malereien erfolgten 1979-1981 und ist dem bürgerschaftlichen Engagement zu verdanken.


1989
Neubeginn seit 1989
„Mit der Ausstellung „1200 Jahre Bietigheim. Etappen auf dem Weg zur Stadt von heute“ kehrte die Stadtgeschichte rechtzeitig zum Jubiläumsjahr wieder in ein Haus ein, das über eine lange Zeit Ausgangspunkt und Zentrum für die Geschichte unsere Stadt gewesen war. “ Mit diesen Worten begann Manfred List, der damals amtierende Oberbürgermeister der Stadt Bietigheim-Bissingen, sein Vorwort im ersten Ausstellungskatalog des im März 1989 eröffneten Stadtmuseums Hornmoldhaus. Seither widmet sich das Haus der Geschichte der Stadt Bietigheim-Bissingen und setzt sich in seiner ständigen Ausstellung sowie jährlich zwei bis drei Wechselausstellungen mit der Lokal-, Regional- und Kulturgeschichte auseinander.
Ständige Ausstellung
Raum Bietigheim-Bissingen
Von den Anfängen zur Zeit der Römer bis etwa 1970
Die ständige stadtgeschichtliche Ausstellung hat im Hornmoldhaus eine ideale Bleibe gefunden: Auf rund 400 Quadratmetern erfahren Sie, wie sich der Raum Bietigheim-Bissingen von seinen Anfängen zur Zeit der Römer bis etwa 1970 entwickelt hat. Aus der unmittelbaren Konfrontation mit sichtbaren Zeugnissen vergangener Zeiten lässt sich dem Alltag unserer Vorfahren nachspüren. So kann der Besucher etwa Näheres über das Leben und Arbeiten auf dem römischen Gutshof „Weilerlen“ erfahren. Als besondere Anziehungspunkte gelten die Malereien des Hauses und besonders der Sommerstube sowie das Erwin-Baelz-Kabinett, das an den in Japan wirkenden Bietigheimer Mediziner erinnert. Weitere interessante Exponate sind das Weinregister und das Stadtmodell.
Näheres zu Führungen finden Sie auf der Homepage des Stadtmuseums..